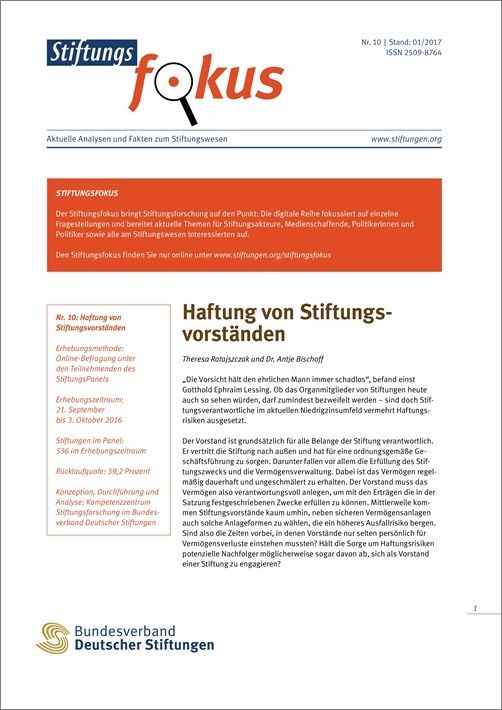
Haftung von Stiftungsvorständen: Wie Stiftungen sich vor Schäden absichern
Warum sind die Dokumentation von Entscheidungsgründen und schriftliche Anlagerichtlinien wichtige Instrumentarien zur Haftungsvermeidung?
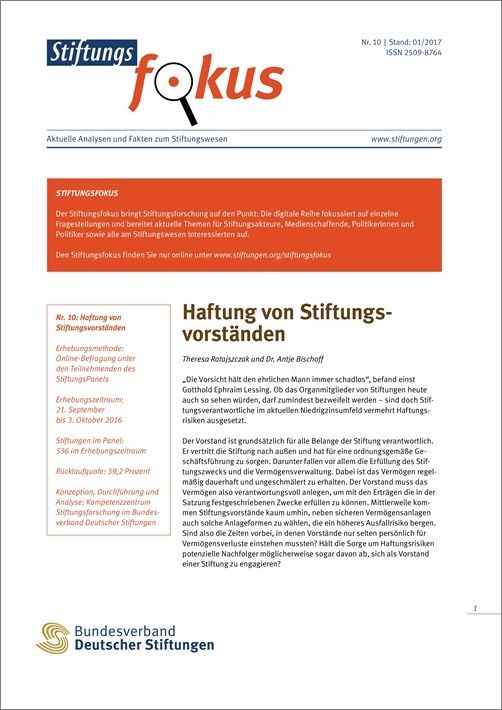
Der Vorstand ist grundsätzlich für alle Belange der Stiftung verantwortlich. Er vertritt die Stiftung nach außen und hat für eine ordnungsgemäße Geschäftsführung zu sorgen. Darunter fallen vor allem die Erfüllung des Stiftungszwecks und die Vermögensverwaltung. Dabei ist das Vermögen regelmäßig dauerhaft und ungeschmälert zu erhalten. Der Vorstand muss das Vermögen also verantwortungsvoll anlegen, um mit den Erträgen die in der Satzung festgeschriebenen Zwecke erfüllen zu können. Angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase kommen Stiftungsvorstände kaum umhin, neben sicheren Vermögensanlagen auch solche Anlageformen zu wählen, die ein höheres Ausfallrisiko bergen.
Stiftungen nutzen ein Bündel von Maßnahmen, um sich vor Haftungsfällen zu schützen
Stiftungen haben vielfältige Möglichkeiten, sich vor dem Eintreten eines Haftungsfalls zu schützen bzw. solche Haftungsfälle abzusichern. Knapp zwei Drittel der befragten Stiftungen gehen den empfohlenen Weg, die Gründe von Entscheidungen schriftlich zu dokumentieren. Mehr als die Hälfte der Befragten hat außerdem ihre Anlagerichtlinien schriftlich festgelegt. Diese schützen zwar nicht per se vor Haftung, geben aber den Organen einen Handlungsleitfaden für ihre Entscheidungen im Rahmen der Vermögensbewirtschaftung. Über 15 Prozent der befragten Stiftungen haben hingegen keine konkreten Maßnahmen zur Absicherung getroffen.
Maßnahmen zur Vermeidung und Absicherung von Haftungsfällen
Die schriftliche Festlegung von Anlagerichtlinien und die schriftliche Dokumentation von Entscheidungsgründen sind kostengünstige Maßnahmen – sieht man von der Arbeitszeit und den damit gegebenenfalls verbundenen Personalkosten einmal ab. Insofern verwundert es, dass die befragten kleinen Stiftungen diese Schritte deutlich seltener gehen als große. Bei teuren Maßnahmen wie z.B. der Einbindung externer Berater und dem Abschluss einer D&O-Versicherung liegt es nahe, dass sie von großen Stiftungen deutlich häufiger genutzt werden als von kleinen. Gänzlich auf Maßnahmen zur Vermeidung und Absicherung von Haftungsfällen verzichten lediglich knapp 5 Prozent der befragten großen Stiftungen, bei den kleinen sind es rund 28 Prozent.
Die Verteilung der Maßnahmen getrennt nach ehrenamtlich tätigen Vorständen und solchen, die über 720 Euro jährlich erhalten, ergibt ein ähnliches Bild wie bei den kleinen und großen Stiftungen: Sowohl die kostengünstigen als auch die teuren Maßnahmen werden von Stiftungen, deren Vorstandsmitglieder mit mehr als 720 Euro im Jahr vergütet werden, häufiger genutzt. Eine Erklärung könnte sein, dass diese Vorstände für jede Art von Fahrlässigkeit haften – es sei denn, die Satzung sieht für sie eine Haftungsprivilegierung vor – und sie somit ein höheres Risiko tragen, haftungsrechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden.
Immerhin drei von vier befragten Stiftungen haben sich bereits zum Thema Haftung kundig gemacht. Bei den großen Stiftungen sind es sogar 82 Prozent, bei den kleinen Stiftungen immerhin 66 Prozent.
Informierte Stiftungen können Haftungsrisiken besser einschätzen
Stiftungen, die sich bereits zum Thema Haftung kundig gemacht haben, ergreifen auch deutlich häufiger Maßnahmen zur Vermeidung und Absicherung von Haftungsschäden als jene, die sich noch nicht schlau gemacht haben. Die Befragung zeigt, dass sich beides – Informationen einzuholen und Maßnahmen zu ergreifen – positiv auswirkt. Informierte Stiftungen kennen offenbar haftungsträchtige Fallstricke und können demnach besser beurteilen, wann Pflichtverletzungen bei der Vermögensverwaltung und der Mittelverwendung vorliegen. Auch gehen Stiftungen, die Maßnahmen ergriffen haben, bei der Entscheidungsfindung bezüglich der Vermögensanlage sensibler vor: 86 Prozent dokumentieren die Entscheidungsfindung schriftlich, während Stiftungen, die keine Maßnahmen ergriffen haben, dies nur zu rund 40 Prozent tun.
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es sich lohnt, sich zu Haftungsfragen beraten zu lassen – z.B. in Form von Rechtsberatung oder Fortbildungen.
Alle Zahlen und Fakten im Stiftungsfokus Nr. 10: "Haftung von Stiftungsvorständen"
Theresa Ratajszczak
Alle Beiträge von Theresa RatajszczakDr. Antje Bischoff
Alle Beiträge von Dr. Antje BischoffQuelle
Stiftungsfokus Nr. 10: "Haftung von Stiftungsvorständen"
Jetzt herunterladen
Aktuelle Beiträge
Die Kraft der Frauen
Auch zum 100. Jubiläum des internationalen Frauentages gibt es in Sachen Gleichberechtigung noch viel zu tun. Nur langsam ändern sich Jahrhunderte alte Gesellschaftsstrukturen von Machtverteilung und Diskriminierung. Wie es gehen kann, zeigt die erfolgreiche Arbeit der Vicente Ferrer Stiftung zur Stärkung der Frauen im ländlichen Indien.
MehrDie Alle-an-einen-Tisch-Bringer
ProjectTogether zählt zu den innovativsten Initiativen der Zivilgesellschaft. Auch Stiftungen können beitragen – und mit jungen Ideen die eigene Wirkung potenzieren.
Mehr"Zum Wohle der Witwen und Waisen" – neu interpretiert
Fünf soziale Einrichtungen, darunter einen Seniorentreff, unterhält die Koepjohann’sche Stiftung. In der DDR hatte der Berliner Stiftung, die in diesem Jahr 230 Jahre alt wird, noch das Aus gedroht. Ein Gespräch mit den ehemaligen und amtierenden Kuratoriumsvorsitzenden der Stiftung über die ewige Angst vor Enteignung und die Neuerfindung der Stiftung nach dem Mauerfall.
MehrGrundsteuerreform – Handlungsbedarf für Stiftungen
Die Grundsteuerreform betrifft auch Stiftungen, selbst wenn sie mit ihrem Grundbesitz grundsteuerbefreit sind. Eine erneute Prüfung der Steuerbefreiung ist nicht ausgeschlossen.
Pressemitteilungen
Erfolg für Stiftungen: Bundestag beschließt Stiftungsrechtsreform
In seiner Sitzung vom 24. Juni 2021 hat der Bundestag die dringend notwendige Reform des Stiftungsrechts beschlossen. Der Bundesverband Deutscher Stiftungen begrüßt das neue Gesetz, da es zu mehr Rechtssicherheit führt, sieht jedoch Bedarf für weitere Reformschritte. Stiftungen haben nun mehr Gestaltungsmöglichkeiten für ihre Weiterentwicklung.
Häufige Fragen zur Stiftungsrechtsreform
Wann kommt das Stiftungsregister? Wie ist mit Umschichtungsgewinnen zu verfahren? Können Stiftungen künftig leichter fusionieren? Wir geben einen Überblick.

