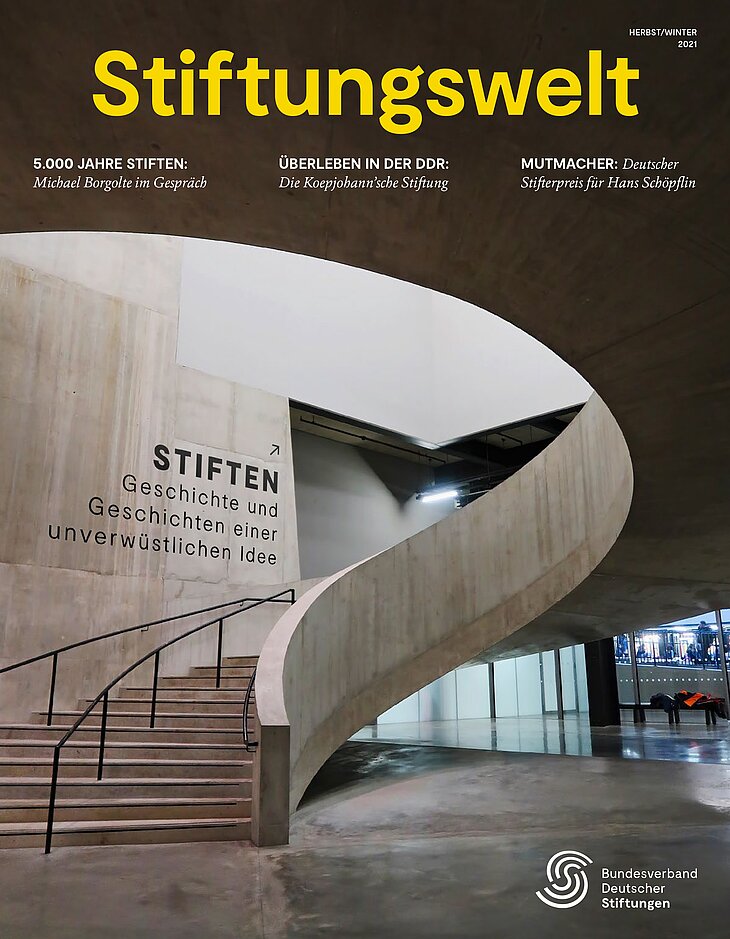"Zum Wohle der Witwen und Waisen" – neu interpretiert

Fünf soziale Einrichtungen, darunter einen Seniorentreff, in dem ältere Menschen nicht nur essen, sondern auch Tipps für den Umgang mit dem Handy bekommen können, unterhält die Koepjohann’sche Stiftung. In der DDR hatte der Berliner Stiftung, die in diesem Jahr 230 Jahre alt wird, noch das Aus gedroht. Mit Martin-Michael Passauer und Prof. Dr. Philipp Enger, ihrem ehemaligen und ihrem amtierenden Kuratoriumsvorsitzenden, sprachen wir über die ewige Angst vor Enteignung und die Neuerfindung der Stiftung nach dem Mauerfall.

Herr Passauer, Herr Professor Enger, wo waren Sie am Tag des Mauerfalls, wie haben Sie den 9. November 1989 erlebt?
Michael Passauer: Wie jedes Jahr am 9. November fand auch an dem Abend in der Sophiengemeinde in Berlin-Mitte, wo ich damals Pfarrer war, eine Gedenkfeier an das Novemberpogrom von 1938 statt. Gleich nach der Veranstaltung musste ich mein Auto, einen Wartburg, zur Reparatur nach Berlin-Weißensee bringen. Da war am Grenzübergang Bornholmer Straße schon allerhand los. Nachdem ich das Auto abgeliefert hatte, habe ich den Bus zurück genommen. Und plötzlich schrie der Busfahrer wie von der Tarantel gestochen: „Mensch Leute, die Mauer is uff, die Mauer is uff!“ Der hat sich so gefreut, dass der Bus ins Schlingern gekommen ist. Wir Fahrgäste haben alle gedacht: „Oh Gott, der ist verrückt geworden! Die Mauer is uff?!“ Diese Freude des Busfahrers, die war so echt – das werde ich nie vergessen!
Prof. Dr. Philipp Enger: Ich war zu der Zeit auf Studienreise in Ungarn, und wir haben von den Ereignissen in Deutschland überhaupt nichts mitbekommen. Am nächsten Morgen erzählte uns die Besitzerin der Pension, in der wir übernachtet hatten, dass sie im österreichischen Rundfunk gehört habe, die Mauer sei gefallen. Da haben wir alle gelacht und gesagt: „Die Österreicher, was die sich alles einfallen lassen!“ Wir haben das einfach nicht geglaubt.
Herr Passauer, Sie waren damals nicht nur Pfarrer der Sophiengemeinde, sondern auch Kuratoriumsvorsitzender der Koepjohann’schen Stiftung, die 1792 von dem Berliner Schiffbaumeister Johann Friedrich Koepjohann gegründet worden war. Wie sind Sie zu diesem Amt gekommen?
Passauer: 1984 habe ich eine von zwei Pfarrstellen der Sophiengemeinde übernommen. Und ich sehe mich noch mit Johannes Hildebrandt, der dort schon viele Jahre Pfarrer war, im Gemeindesaal von Sophien am Fenster stehen und höre mich fragen: „Pfarrer Hildebrandt, wie kann ich Sie denn unterstützen?“ Und er antwortete: „Wie Sie sehen, haben wir hier Häuser mit 90 Wohnungen, die alle zu Sophien gehören, und einen Kindergarten und zwei große Friedhöfe und die schöne Kirche und den Park. Und dann haben wir da noch eine Stiftung in der Friedrichstraße mit noch einmal 80 Mietwohnungen, die verwaltet werden müssen. Das wäre doch ganz schön, wenn Sie die Geschäftsführung dieser Stiftung übernehmen würden.“ So habe ich zum ersten Mal von Koepjohann und seiner Stiftung gehört.
Der Pfarrer als Hausverwalter?
Passauer: Ja, daran kam man als Pfarrer der Sophiengemeinde nicht vorbei. Die Stiftung hatte zwar eine Hausverwaltung, aber wenn es Trouble mit den Mietern gab, etwa weil ein Abfluss nicht funktionierte, musste ich mich kümmern. „Liebe Leute“, habe ich dann zu ihnen gesagt, „ihr wohnt hier in fürstlichen Wohnungen und zahlt kaum Miete. Und wir sind eine Stiftung, wir bekommen kein Geld und müssen alles selbst machen. Denn wir unterstehen nicht der Sophiengemeinde, sondern sind eine selbstständige Stiftung.“ Also, das Leben der Stiftung war sehr schwer.
Inwiefern?
Passauer: Weil die Erträge, die wir aus den Mieten generieren konnten, nicht ausreichten, um den
Stiftungszweck zu erfüllen. Dieser besteht bis heute darin, sich um die Witwen und Waisen aus der Familie des Stifters und der Spandauer Vorstadt (so heißt das Viertel westlich der Friedrichstraße, in dem die Koepjohann’sche Stiftung ihren Sitz hat , Anm. d. Red.) zu kümmern und sie finanziell zu unterstützen. Ich erinnere mich noch gut an meine erste Begegnung mit den Koepjohannitinnen, wie die Begünstigten der Stiftung genannt werden. Da saßen acht oder zehn Frauen im Gemeindesaal von Sophien, jede mit zwei Stückchen Kuchen vor sich. Das war der Erlös der Stiftung, mehr fiel nicht ab. Im nächsten Jahr haben wir das etwas steigern können, da bekam jede 50 Ostmark. Die haben wir zwar aus der Kirchenkasse genommen, aber immerhin. Wir mussten der Stiftungsaufsicht gegenüber ja immer nachweisen, dass wir eine mildtätige Stiftung sind und das auch bleiben wollen.
Wie hat es die Koepjohann’sche Stiftung unter diesen Bedingungen geschafft, die Zeit bis zur Wende zu überstehen?
Passauer: Das ist allein der Weitsichtigkeit ihres Gründers zu verdanken. Der gute Koepjohann hat bei Gründung der Stiftung mindestens drei Dinge richtiggemacht. Zum einen hat er, da er selbst kinderlos war, seiner Verwandtschaft und der seiner Frau einen Teil seines Erbes zugesprochen. Zum anderen wollte er mit seiner Stiftung den Armen helfen. Ende des 18. Jahrhunderts waren das vor allem die Witwen und Waisen, deren Männer bzw. Väter in den Revolutionskriegen umgekommen waren. Und schließlich hat er sich gefragt, wem er die Stiftung nach seinem Tod anvertrauen könnte. Und hat sich gesagt – das unterstelle ich ihm, das ist mein Hymnus auf ihn: „Kaiser und Könige kommen und gehen. Aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit.“ Daraufhin hat er sich entschieden, diese Stiftung irgendwie an die Kirche anzubinden. Und das, obgleich er nicht sonderlich kirchlich war, soweit ich weiß.
Enger: Nun, er hat schon einiges an die Sophiengemeinde gespendet, die Orgel in der Sophienkirche zum Beispiel.
Passauer: Stimmt. Jedenfalls hat er testamentarisch verfügt, dass immer ein Pfarrer der Sophiengemeinde Vorsitzender des Kuratoriums der Koepjohann’schen Stiftung sein soll. Später wurde die Satzung dahingehend geändert, dass der Kuratoriumsvorsitzende nicht zwangsläufig hauptamtlich Pfarrer in Sophien sein muss.
Warum meinen Sie, dass diese Anbindung an die Kirche eine kluge Entscheidung war?
Passauer: Weil die Stiftung dadurch unter dem Schutz der Kirche stand. Das war überlebenswichtig. Die Sophiengemeinde wurde damals aufgrund ihrer kritischen Haltung gegenüber dem Regime kritisch beäugt. Und wenn uns die DDR-Funktionäre etwas Böses wollten – und das wollten sie immer –, haben sie damit gedroht, uns Koepjohann wegzunehmen. Dann habe ich entgegnet: „Wir sind eine kirchliche Stiftung, als Pfarrer bin ich ihr Vorsitzender, und Sie können uns nicht enteignen. Da müssten Sie schon die gesamte Kirche enteignen.“ Das haben sie sich dann doch nicht getraut. Insofern war das Wort „kirchliche Stiftung“ so etwas wie ein Schutzmantel.
Obwohl es in der Sache nicht ganz zutrifft, oder?
Passauer: Na ja, die Verbindung zwischen Stiftung und Gemeinde ist schon sehr eng. Die Kirche wählt zum Beispiel die Witwen und Waisen aus, die unterstützt werden sollen. Was die Koepjohann’sche Stiftung von anderen diakonischen Stiftungen unterscheidet, ist, dass sie bis heute der staatlichen Stiftungsaufsicht untersteht, nicht der kirchlichen. Das hat der Stiftung gutgetan.
Inwiefern?
Passauer: Weil sie sich dadurch ihre Unabhängigkeit von der Kirche, die ja auch ihre Interessen hat, bewahren konnte. Wenn die Mitglieder des Kuratoriums, damals allesamt ältere Männer, ihre Köpfe geschüttelt haben, ging gar nichts, da hätte sich der Gemeindekirchenrat von Sophien auf den Kopf stellen können. Keine Ideologie, keine Vorgaben durch die Kirche – abgesehen davon, dass es nicht gern gesehen wurde, wenn am 1. Mai Fahnen herausgehängt wurden, wie es in der DDR üblich war. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwelche Spitzel hatten. Das müssten dann noch einmal Historiker recherchieren, ob es so etwas gegeben hat. Auf jeden Fall sind wir, von ein paar Angriffen staatlicher Stellen abgesehen, glimpflich davongekommen.
Worin gründete die Stiftungsfeindlichkeit der DDR?
Passauer: Die DDR-Ideologie umfasste mindestens drei Grundsäulen. Die eine war die Diktatur des Proletariats, die andere die Vergesellschaftung der Privatverhältnisse, die dritte war der Atheismus. Und die Vergesellschaftung des Eigentums betraf auch die Stiftungen. Das war Eigentum, an das der Staat nicht herankam. Das hat ihn geärgert, weil er ja fast alles vergesellschaftet hat bis auf wirkliches Privateigentum. Private Häuser und Grundstücke hat er sich nur dann genommen, wenn es militärischen Zwecken wie der Grenzsicherung diente. Aber öffentliche Einrichtungen – die sind alle in gesellschaftliches Eigentum überführt worden. Das hätte er mit der Stiftung auch sehr gern
gemacht, weil die Gegend mit dem Bahnhof und Grenzübergang Friedrichstraße und dem Berliner Ensemble schon damals nicht uninteressant war.
Enger: Und das war eben die vierte sehr kluge Entscheidung Koepjohanns: Er hat verfügt, dass die Gebäude und die Grundstücke der Stiftung nie veräußert werden dürfen, es sei denn zum Erhalt des Stiftungsvermögens. Solche Tendenzen gab es immer wieder, gerade zu Ende des 19. Jahrhunderts. Das war ja eine sehr arme Gegend hier, und die Mieten haben damals auch nicht viel eingebracht. Auch damals schon haben die Kuratoriumsmitglieder gejammert, wie viel Arbeit das alles macht und wie wenig dabei herauskommt. Und sie haben immer wieder versucht zu verkaufen. Die Stiftungsaufsicht hat das aber nie genehmigt – zum Glück.
Weshalb zum Glück?
Weil das Stiftungsvermögen nur dadurch die Turbulenzen des 20. Jahrhunderts überstanden hat. Die Hyperinflation und die darauffolgende Währungsreform 1923 konnten ihm nichts anhaben. Und die DDR kam auch nicht ran, denn es ist ja schon ein Unterschied, ob man ein Konto einzieht oder ein Gebäude enteignet. Die größte Krise, die diese Stiftung durchgemacht hat, kam erst nach der Wende.
Dabei sollte man meinen, dass die Stiftung mit dem Ende der DDR das Schlimmste überstanden hätte.
Enger: Im Grunde war diese Krise eine Spätfolge der DDR. Da die Stiftung zu DDR-Zeiten fast keinen Zugang zu Baumaterialien hatte, waren ihre Häuser dringendst sanierungsbedürftig. Diese Situation hat die Stiftung in eine finanzielle Schieflage gebracht. Ende der 1990er-Jahre mussten dann die Grundstücke auf der anderen Seite der Albrechtstraße, die mehr oder weniger unbebaut waren, veräußert werden, um diese Seite – und damit die Stiftung insgesamt – zu retten.
Passauer: Ja, das war eine schwierige Zeit. Wir hatten das Glück, dass ein findiges Architekturbüro aus dem Westen unsere Häuser interessant fand und alle möglichen Sonderprogramme angezapft hat, um erst einmal die notwendigsten Sanierungsarbeiten machen zu können. Dann gab es Riesenkrach mit den Mietern, weil wir die Miete anheben mussten: „Herr Passauer, von der Kanzel predigen Sie Nächstenliebe und uns ziehen Sie das Geld aus der Tasche.“ Und die Stiftungsaufsicht wollte uns untersagen, die Grundstücke zu verkaufen. Sie hat erst eingewilligt, als wir ihr klarmachten, dass wir das Erbe Koepjohanns nur verwalten können, wenn wir einige Grundstücke verkaufen.
Inwieweit waren solche Probleme typisch für die Situation ostdeutscher Stiftungen nach der Wende?
Enger: Der Sektor der öffentlichen Wohlfahrt in der alten Bundesrepublik und dann im vereinigten Deutschland ist bis heute ein marktwirtschaftlich organisiertes und hart umkämpftes Feld. Viele ostdeutsche Stiftungen in der DDR stellte es vor große Herausforderungen, sich in diesem Feld zu behaupten – zumal sogleich westdeutsche Konkurrenten wie etwa Bethel, der große diakonische Konzern, auf den ostdeutschen Markt drängten. Dieser Systemwechsel hat gerade den diakonischen Stiftungen zu schaffen gemacht.
Passauer: Und auch die neue Gesetzgebung. Ein kluger Mensch hat einmal gesagt: „Als DDR-Bürger hätte ich nicht gedacht, dass die Bürokratie des Sozialismus noch zu überbieten ist.“ Gerade im sozialen Bereich mit seinen unendlich vielen Vorgaben, etwa zu der Frage, wer als Mensch mit Behinderung Anspruch auf welche Leistung hat. Das war doch für ostdeutsche Stiftungen alles neu.
Die Koepjohann’sche Stiftung scheint diese Lernkurve sehr erfolgreich absolviert zu haben: Heute unter hält sie mehrere eigene soziale Einrichtungen und hat ihr Stiftungsgebiet auf den gesamten Stadtbezirk Mitte mit den ehemals westdeutschen Vierteln Moabit und Wedding ausgedehnt.
Enger: Letzteres hängt auch damit zusammen, dass uns in unserem bisherigen Stiftungsgebiet, etwas flapsig gesagt, allmählich die Witwen und Waisen ausgingen, weil die Spandauer Vorstadt heute durchgentrifiziert ist. Insofern hat die Stiftung von der Gentrifizierung profitiert. Denn wir konnten die Stiftungsaufsicht überzeugen, das Stiftungsgebiet auf Stadtteile mit echten sozialen Brennpunkten auszudehnen, wo Einrichtungen wie unsere dringend benötigt werden.
Vor dem Hintergrund, dass Ihre Stiftung inzwischen auch im alten Berliner Westen aktiv ist: Inwieweit fühlen Sie sich noch als Vertreter einer ostdeutschen Stiftung?
Enger: Ich würde sagen, es ist eine Berliner Stiftung. Und mit der Geschichte dieser Stadt, mit ihrem Auf und Ab, ihrem Wohl und Wehe, aufs Engste verbunden. Das ist etwas sehr Besonderes. Im Rahmen dieser Berliner Geschichte war sie eine Zeitlang eine Ostberliner Stiftung: Sie liegt im alten Ostteil mit seinem besonderen Geschick. Insofern ist es immer noch eine Ostberliner Stiftung. Aber sie ist nicht mehr durch die DDR geprägt, sondern durch die Entwicklung der östlichen Bezirke, die sich, etwas polemisch gesagt, mit den Worten Gentrifizierung, Haifisch-Kapitalismus sowie Kultur- und Partyexplosion umschreiben lässt.
Die Geschichte der Stiftungen in der DDR ist noch längst nicht umfassend erforscht. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Passauer: Daran, dass es in der DDR nie ein kollektives Stiftungsbewusstsein im Sinne von „Wir Stiftungen“ gab. Jede Stiftung hat versucht, sich auf ihre Weise über die Runden zu retten. Die großen diakonischen Stiftungen haben sich über das Stichwort Diakonie und ihre inhaltliche Arbeit definiert. Die Selbstwahrnehmung als Stiftung spielte dabei keine große Rolle.
Wie ist das mit Ihrer eigenen Stiftungsgeschichte? Werden Sie diese aufarbeiten lassen?
Enger: In einem umfassenden Sinne ist das nicht geplant. Wir sind eine kleine, ich würde sagen: feine, aber nicht besonders einflussreiche Stiftung. Eine wissenschaftliche Aufarbeitung könnte ich mir nur im Kontext einer Erforschung der gesellschaftlichen Rolle von Stiftungen insgesamt vorstellen. Für die Geschichte des 19. Jahrhunderts wäre das, glaube ich, hochgradig interessant.
Über die Gesprächspartner
Martin-Michael Passauer wurde 1984 Pfarrer an der Sophienkirche in Berlin-Mitte. Von 1988 bis 1991 war er persönlicher Referent von Bischof Gottfried Forck. 1996 wurde Passauer Generalsuperintendent des Sprengels Berlin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg. Der Koepjohann’schen Stiftung stand er von 1984 bis 2008 vor.
Dr. Philipp Enger ist Professor für Biblische Theologie und Evangelische Religionspädagogik an der Evangelischen Hochschule Berlin und Kuratoriumsvorsitzender der Koepjohann’schen Stiftung. Zudem ist er ehrenamtlicher Pfarrer in der Gemeinde am Weinberg, zu der die Sophienkirche gehört.
Aktuelle Beiträge
Interview zur Strategie 2025 des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen
Aktive Interessenvertretung, eine starke Stimme der Zivilgesellschaft, zielgruppenspezifische Services und Netzwerke, Einsatz für die Zukunft des Stiftens: Generalsekretärin Kirsten Hommelhoff und die Vorstandsvorsitzende Friederike von Bünau sprachen mit Stifter TV über die Strategie 2025.
MehrVirtuelle Sitzungen auch ohne Sonderregelung? Hinweise zur aktuellen Rechtslage
Zum 31. August 2022 endet die Corona-Sonderregung für digitale Organsitzungen. Was plant der Gesetzgeber? Was sollten Stiftungen nun beachten? Ein Überblick.
Mehr„Wir haben uns etwas sagen zu lassen“
Als im Mai dieses Jahres der Afroamerikaner George Floyd von einem Polizisten getötet wurde, erklärte sich das Stadtmuseum Berlin als eine von wenigen Stiftungen in Deutschland offen solidarisch mit der weltweit aufkommenden #BlackLivesMatter-Bewegung. Im Gespräch erklären Direktor Paul Spies und Diversitäts-Agentin Idil Efe, wie sie ihr eigenes Haus bunter machen wollen.
Mehr"Stiftungen müssen einen unübersehbaren Beitrag zu den großen Fragen unserer Zeit leisten"
Bildung, Digitalisierung, Gesundheit, Klima, gesellschaftlicher Zusammenhalt: Stiftungen spielen eine wichtige Rolle in unserer Demokratie. In seiner Dankesrede ruft Stifterpreisträger Hans Schöpflin zu mehr Engagement von Stiftungen auf.
"Die Idee der Stiftung überdauert"
Michael Borgolte ist einer der führenden Experten für die Geschichte der Philanthropie. Im Interview erzählt der Historiker, wie er Stiftungskulturen weltweit erforscht, weshalb exzessives Stiften im alten Ägypten zum Zusammenbruch des Staates führte und warum der Ewigkeitsgedanke von Stiftungen nicht zu ernst genommen werden sollte.
Der Mutmacher Hans Schöpflin – eine Würdigung
Nichts im Leben bleibt, wie es ist: Diese tief durchlebte Erkenntnis zeichnet den Träger des Deutschen Stifterpreises 2020 aus und begründet seine Philanthropie. Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen am 11. November 2021 in Frankfurt am Main wird dem Unternehmer Hans Schöpflin die höchste Auszeichnung des deutschen Stiftungswesens verliehen.