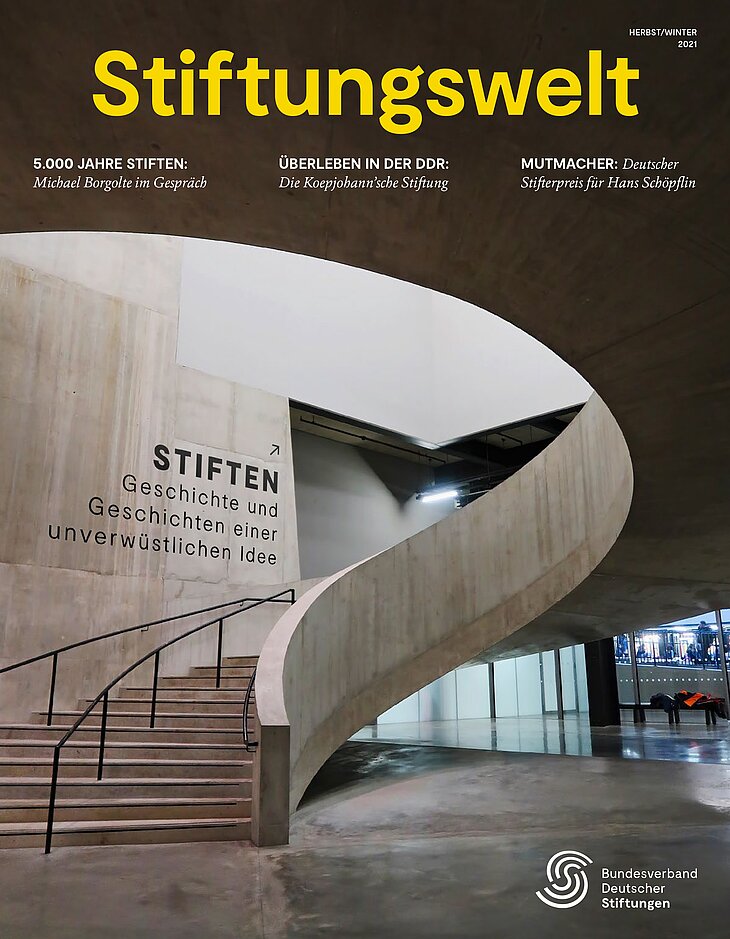"Die Idee der Stiftung überdauert"

Michael Borgolte ist einer der führenden Experten für die Geschichte der Philanthropie. Im Interview erzählt der Historiker, wie er Stiftungskulturen weltweit erforscht, weshalb exzessives Stiften im alten Ägypten zum Zusammenbruch des Staates führte und warum der Ewigkeitsgedanke von Stiftungen nicht zu ernst genommen werden sollte.
Stiftungswelt: Herr Professor Borgolte, Ihre Forschung konzentriert sich auf das Altertum und das Mittelalter, also grob gesagt auf den Zeitraum 3000 vor bis 1500 unserer Zeitrechnung. Können Sie einen historischen Moment benennen, an dem man erstmals von so etwas wie dem „Stiften“ sprechen kann?
Prof. Michael Borgolte: Die ersten Stiftungen lassen sich in Mesopotamien und im Alten Ägypten zu Beginn des dritten vorchristlichen Jahrtausends nachweisen; sie waren entweder dem Kult von Göttern oder von Ahnen gewidmet. Was mich aber lange beschäftigt hat, ist die Frage, ob Stiftungen einmal erfunden und dann weitergegeben werden oder ob das Stiften eine so einfache Idee ist, dass sie unabhängig voneinander zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten der Welt auftaucht.
Haben Sie eine Antwort gefunden?
Ja, aber erst kürzlich. Als ich 2017 meine Weltgeschichte der Stiftungen schrieb, habe ich diese Frage noch offenlassen müssen. Danach habe ich mich jedoch mit der Inkakultur in Südamerika beschäftigte, die sich bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts zurückverfolgen lässt. Dabei habe ich festgestellt, dass die Spanier bei der Eroberung des Inkareiches im Jahr 1532 den Kult wie eine Stiftung beschrieben. Bei den Inka wurde die Sonne als Gott verehrt. Der Sonne gehörten Ländereien, im Grunde also Immobilien, die jedes Jahr Erträge abwarfen, die dann für den religiösen Kult eingesetzt wurden. Wenn dies so richtig beschrieben ist, handelte es sich um keine Finanzierung aus dem Staatshaushalt.
Was heißt das für die Erfindung der Stiftung?
Da die Inka unberührt von der europäischen, afrikanischen und asiatischen Kultur entstanden sind, ist damit der Nachweis geführt, dass Stiftungen unabhängig voneinander an unterschiedlichen Orten der Welt und zu unterschiedlichen Zeiten erfunden wurden. Im eufrasischen Kulturraum existierten dagegen so viele Austauschbeziehungen, dass man nicht sicher sagen kann, ob es hier auch Neuerfindungen gab. Man kann es aber auch nicht ausschließen.
Lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten. Muss man sich, bevor man nach den Spuren des Stiftens in der Geschichte sucht, nicht die Frage stellen: Was ist Stiften überhaupt? Oder wollen Sie als Historiker umgekehrt herausfinden, was Stiften quasi geworden ist?
Das ist eine methodisch zentrale Frage. Natürlich geht man an solch ein Thema mit einer Arbeitshypothese heran. Beispielsweise muss man Stiftungen von Schenkungen oder anderen Gabeformen unterscheiden. Dann geht man von herrschenden Definitionsversuchen aus, die sich im Fall des Stiftens allerdings alle als nicht tragfähig erwiesen haben, denn keine Definition trifft auf sämtliche Phänomene des Stiftens zu. Beispielsweise gibt es gerade in der Moderne – aber auch in der Vormoderne – Stiftungen, die zeitlich befristet sind und ihr Kapital verbrauchen. Deshalb spreche ich im Sinne Max Webers von einem Idealtyp, also einem Definitionsversuch, der weitestgehend zutrifft.
Wie würden Sie die Idee der Stiftung also beschreiben?
Die Idee ist relativ einfach: Es ist ein Kapital erforderlich, das selbst nicht verbraucht wird und von dem nur die Zinsen für einen dauerhaften Zweck zur Verfügung gestellt werden. Dafür müssen bestimmte Voraussetzungen existieren, die man definieren kann. Zum Beispiel muss es eine Wirtschaftsform geben, die mehr Ertrag abwirft als konsumiert werden kann, sodass ein Rest übrig bleibt. Das war erst seit der sogenannten landwirtschaftlichen Revolution, die etwa im zweiten Jahrtausend vor unserer Zeit einsetzte, der Fall. Seitdem konnte mehr Korn produziert werden als in einem Jahr verbraucht wurde. Der Archäologe Peter Bellwood nannte das die „erste reiche Ernte“. Eine andere Voraussetzung des Stiftens ist, dass es nicht nur staatliches, sondern auch privates Eigentum gibt.
In Ihrem Standardwerk „Weltgeschichte als Stiftungsgeschichte“ schreiben Sie: „Stiftungen sind ein totales soziales Phänomen, an denen sich das Gefüge ganzer Gesellschaften ablesen lässt.“ Wie meinen Sie das?
Mit „total“ meine ich, dass das Phänomen Stiftung alle wichtigen Aspekte der Gesellschaft umfasst: Es ist ein kulturelles, ein politisches, ein religiöses, ein wirtschaftliches Phänomen usw. Daher eignet sich die Stiftung auch so gut als Schlüssel zu Gesellschaften.
Inwiefern?
Die Geschichtswissenschaft ist ja weitgehend davon abgekommen, die Geschichte einer einzelnen Nation, eines Staates oder eines Volkes zu erforschen. Stattdessen will man heute im globalen Sinne Kulturen und Länder miteinander vergleichen. Um dies zu ermöglichen, braucht es bestimmte Einzelphänomene wie die Stiftung. Man kann etwa fragen, wie Stiften in verschiedenen Gesellschaften funktioniert. Insofern bietet sich der Vergleich als moderne geschichtswissenschaftliche Operation an, um einerseits von der eigenen Gesellschaft zu abstrahieren. Andererseits lässt sich so genauer differenzieren, wie sich Gesellschaften entwickeln und wo es Abbrüche gibt. So etwas lässt sich über Stiftungen wunderbar erforschen.
Lassen Sie uns zurück zu den Anfängen der Stiftung kommen. Wenn Stiftungen zuerst um 3000 vor unserer Zeitrechnung belegt sind, haben sie sich dann kontinuierlich entfaltet?
Universalhistorisch gesehen gibt es Stiftungen seit ungefähr 5.000 Jahren. Das Phänomen des Stiftens hat es in allen Hochkulturen der Weltgeschichte gegeben, allerdings ist es bei Weitem nicht überall gleichmäßig und kontinuierlich vorhanden. Wenn das Stiften einmal erfunden ist, kann es auch wieder abreißen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut entstehen. Es gibt also keine aufsteigende Linie des Stiftens, sondern immer wieder Erfindungen, Neuerfindungen und Abbrüche. Wirklich phänomenal an der Idee der Stiftung ist: Egal wie oft sie in der Geschichte obsolet, abgeschafft, überwunden oder missbraucht wird – letztendlich kommt sie immer wieder auf.
Gibt es Gemeinsamkeiten in den unterschiedlichen Kulturen?
Es gibt durchaus Phänomene, die überall festzustellen sind. Dazu zählt, wie schon erwähnt, die Möglichkeit von privatem Besitz oder die Erwirtschaftung von Überschüssen. Oft finden sich Stiftungen zudem in urbanisierten Hochkulturen.
Warum?
Als sich durch die Verstädterung Siedlungen dezentralisierten, kam es zu massenhafter Abwanderung vom Lande in die Stadt; dadurch war die Versorgung der Ahnengräber in den ländlichen Siedlungen gefährdet. Stiftungen boten eine Möglichkeit, die Pflege des Gedenkens an den Gräbern weiterhin sicherzustellen. Neben Götterstiftungen sind Ahnenstiftungen die Urform der Stiftungen. Besonders in der chinesischen Stiftungskultur spielte die Versorgung der Ahnen durch Stiftungen eine sehr große Rolle.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Der große Gelehrte Konfuzius etwa ist in seinem Geburtsort Qufu bestattet worden. Für den Erhalt seines Grabes gründeten die Kaiser von China so viele Stiftungen, dass seine riesige Verwandtschaft – Tausende von Menschen – bis zur marxistischen Revolution 1947 davon leben konnte.
Welche Motive frühen Stiftens gab es außerdem?
Der archaischen Vorstellung zufolge müssen die Menschen durch Opfergaben die Götter speisen, damit diese leben können. Um dabei eine Regelmäßigkeit zu gewährleisten, wurden Stiftungen gegründet.
In unserem westlichen Kulturraum ist dagegen das Kloster die typische Stiftung. Klöster wurden gestiftet, um die Mönche oder Nonnen zu versorgen, die im Gegenzug für die Toten beten mussten. Die Klöster wiederum betrieben ihrerseits oft Krankenhäuser oder Schulen, deren Schüler bzw. Patienten für die Toten beten mussten.
Gibt es eine Art Kipppunkt, an dem sich das religiöse Moment des Stiftens mit der Sorge um andere verbindet?
Ja, mit dem Beginn der sogenannten Achsenzeit, die in etwa auf das zweite Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung datiert wird, lässt sich dieser Punkt sogar ziemlich genau benennen. Bis dahin stellte man sich die Gesellschaft als einen Kosmos vor, in dem die Menschen- und die Götterwelt eins und ununterscheidbar sind und auch die Toten weiterhin zur Gesellschaft gehören. Dieser Kosmos bricht in der Achsenzeit auseinander, und es entsteht die Transzendenz, also eine Trennung von Diesseits und Jenseits.
"Im Alten Ägypten wurde das Stiften so exzessiv betrieben, dass der gesamte Staat zusammenbrach."
Um das Jenseits zu erreichen, müssen bestimmte Leistungen vollbracht werden, in vielen Religionen sind das die guten Taten. Stiftungen sind ein Instrument, eben dies zu tun. Im vorreformatorischen Christentum sollten die guten Werke mittels der Stiftung den eigenen Tod überdauern, weil sie so auch nach dem Tod des Stifters zu seinem Seelenheil wirken konnten. Damit haben Stiftungen ein karitatives Element. Dieses Phänomen der Philanthropie, das allerdings erst die alten Griechen so nannten, kommt etwa zur selben Zeit bei unterschiedlichen Denkern auf: Platon im antiken Griechenland, die Upanishaden in Indien, Konfuzius in China, Zarathustra in Persien – sie alle hatten die Vorstellung, dass man am besten für sich selbst sorgt, indem man für andere sorgt: die sogenannte Goldene Regel.
Bevor diese Ideen entstanden, wurden Stiftungen wie gesagt zur Speisung und Huldigung von Gottheiten errichtet, etwa im alten Ägypten. Dort kann man die Erfindung der Stiftung ziemlich genau in die 2. Dynastie des Alten Reiches, also circa 2800 vor unserer Zeitrechnung, datieren. Das Stiften wurde dann so exzessiv betrieben, dass der gesamte Staat zusammenbrach.
Das Stiften hat den ägyptischen Staat zu Fall gebracht?
Ja! Irgendwann haben die Pharaonen erkannt, wie man mithilfe von Stiftungen über den eigenen Tod hinaus interveniert, indem man sein Grab pflegen oder seinen Leichnam einbalsamieren lässt. Dafür wurde ein Teil des Staatsbesitzes reserviert. Diese Praxis wurde über Jahrhunderte hinweg fortgeführt, sodass letztendlich kein Staatsbesitz mehr übrig blieb. Zudem arbeiteten Millionen Menschen für diese Totenstiftungen, sodass der Staat keine Ressourcen mehr hatte und regelrecht zusammenbrach. Daraufhin wurden die Stiftungen aufgelöst oder verboten, Stiftungskapitalien wurden konfisziert. Noch in der Moderne sind Reformer wie Atatürk oder die Pahlavi in der Türkei bzw. im Iran gegen das exzessive Stiftungswesen eingeschritten. Das muslimische Stiftungswesen ist ja mit Blick auf den europäischen und vorderasiatischen Bereich das bei Weitem aktivste. Und auch im christlichen Kulturraum wurde im 13. Jahrhundert das Stiften eingeschränkt, als in ganz Europa die sogenannten Amortisationsgesetze, also Verbote für Stiftungserrichtungen, erlassen wurden.
Stiftungen haben also nicht immer auf Ewigkeit Bestand?
Gott sei Dank, nein. Es wäre furchtbar, wenn die Dauerhaftigkeit von Stiftungen zu ernst genommen würde, denn sie müssten das Leben irgendwann ersticken. Insofern ist es zwar wichtig, dass Stiftungen ihren Platz behalten. Man muss aber gleichzeitig aufpassen, dass sie nicht zu viel Raum einnehmen. In Deutschland gibt es keine Stiftungen, die so stark sind, aber beispielsweise in den USA ist das eine reale Gefahr. Es ist ein schwieriger Prozess des Abwägens und Aushandelns.
Eine der Stärken heutiger Stiftungen ist ihre Unabhängigkeit. War dies schon immer der Fall?
Durchaus, die Freiheit ist elementar für Stiftungen. Übrigens ist sie auch ein Element, das immer wieder erkämpft worden ist. Auch wenn Herrscher Stiftungen inaugurierten, wie etwa der römische Kaiser Augustus es getan hat, wurde sehr klar zwischen dem Staats- und dem Privathaushalt unterschieden. Als Stifter war Augustus mit seinem eigenen Kapital aktiv, das lässt sich durchaus verifizieren. Vielleicht ist das sogar ein Leitmotiv der Stiftungsgeschichte: Dass Stiftungen nur existieren können, wenn sie ihre Freiheit bewahren.
Dennoch hat es den illegitimen Zugriff auf Stiftungskapitalien immer gegeben. So haben Staaten oftmals Kapital von Stiftungen konfisziert, um damit ihre Kriege zu finanzieren. In solchen Fällen hörten Stiftungen einfach auf zu existieren. Man kann also sagen: Eine Stiftung existiert nur dann, wenn ein Stiftungszweck gegen den Zugriff staatlicher oder auch kirchlicher Gewalt definiert und gesichert werden kann. Hinzu kommt eine stabile Rechtsordnung, die die Stiftung schützt.
Wie wurde das Kapital in früheren Zeiten „angelegt“?
Das typische Stiftungskapital waren Immobilien, meist agrarisch nutzbare Flächen, die einen kalkulierbaren Ertrag erbrachten. Durch diese Erträge wurden dann beispielsweise die Armen gespeist oder aber die Priester und Mönche, die für die Toten beteten. Im islamischen Bereich zählten zudem Geschäfte und sogar ganze Stadtviertel zu den Anlagekapitalien von Stiftungen. Dagegen finden sich wenig direkte Geldstiftungen, da sich Geld zu schnell entwertete.
Ein schönes Beispiel stammt aus dem Nahen Osten: Zubaida, die dritte Ehefrau des Kalifen Harun ar-Raschid von Bagdad Ende des 8. Jahrhunderts, legte auf einer Pilgerstraße von Kufa im Zweistromland nach Mekka, auf der sich arme Leute zu Fuß bewegten, systematisch Brunnen an. Diese Stiftung erfüllt bis heute ihren Zweck und versorgt die Pilger mit Wasser. Es gibt aber auch ganz winzige Stiftungen, deren einziger Zweck darin besteht, dass in einer bestimmten Kirche regelmäßig eine Kerze angezündet wird.
Gerade seit der Jahrtausendwende erleben wir eine große Ausdifferenzierung von Stiftungsformen. Ich denke etwa an gemeinnützige Aktiengesellschaften oder auch an lose Formen des Stiftens wie die sogenannten Giving Circles. Gab es in der Geschichte eine ähnliche Vielfalt?
Durchaus. Es gab etwa in Indien bäuerliche Stiftungen, die genossenschaftlich organisiert waren: Viele Bauern mit wenig Kapital taten sich zusammen, um beispielsweise eine Schule für ihre Kinder zu stiften. Auch Kaufleute haben sich zusammengeschlossen, um über eine Stiftung eine Schule zu gründen oder ein Schiff auszurüsten.
Eine frühe Form der Bürgerstiftung?
Ganz genau. Ich halte demnächst einen Vortrag über die Gemeinwohlstiftung in der Vormoderne. Das ist ein schwieriges Thema, weil es den Begriff Gemeinwohl zu dieser Zeit gar nicht gab. Gemeint ist damit der Bau von Brunnen, Kanälen, Bewässerungsanlagen, auch die Abfallbeseitigung usw. Normalerweise sind diese Dinge städtisch organisiert. Aber genau wie heute reichten die öffentlichen Instrumente meist nicht aus, weshalb Privatinitiative dazukommen musste. Diese Form von Gemeinwohlstiftungen gibt es vor allem in China, aber auch im antiken Rom. Cicero hat berichtet, dass die armen Leute in mehrstöckigen Mietshäusern ohne Bad lebten. Deshalb animierte er andere dazu, Bäder zu stiften. So entstanden kommunale Bäder, die von mehreren Privatpersonen gestiftet wurden. In Griechenland gibt es ebenfalls Bäderstiftungen, dort wurden sie allerdings für die Sportler errichtet.
"Je konkreter Sie einen Stiftungszweck festschreiben, desto zeitgebundener ist er."
Einer Studie des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen aus dem Jahr 2015 zufolge werden Stiftungen heutzutage vor allem aus uneigennützigen Motiven errichtet. Als Grund wird etwa Verantwortungsbewusstsein genannt oder der Wunsch, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Wann kommt diese Motivation des Stiftens auf?
In unserer Kultur hat natürlich die Reformation stark gegen die Vorstellung opponiert, das Seelenheil könnte durch gute Werke bewirkt werden. Daher gab es zu dieser Zeit auch eine massive Kritik an Stiftungen. Zum zweiten Mal kommt eine solche Stiftungskritik in der Aufklärung auf. Immanuel Kant etwa hat das Prinzip der Stiftung verworfen. Er meinte, Stiften sei nur eitles Getue und es ginge dem Stifter lediglich um das Überdauern seines Namens. Das trifft partiell sicherlich zu, auch heute noch werden Stiftungen oft nach den Stifterpersönlichkeiten benannt. Vor allem aber kritisierte er, eine Stiftung sei ein sozial retardierendes Moment: Wenn man den Zweck einer Stiftung auf Dauer festschreibt, kann sich nichts mehr entwickeln. Diese Kritik muss man ernst nehmen. Denn es stimmt ja auch: Je konkreter Sie einen Stiftungszweck festschreiben, desto zeitgebundener ist er.
Heute wird im Stiftungswesen immer wieder die Frage gestellt, inwiefern Stiftungen ein Ort gesellschaftlicher Innovationen sind. Wenn wir den Blick in die Geschichte werfen, was würden Sie sagen: Gingen Innovationen und entscheidende Anstöße zur Veränderung von Stiftungen aus?
Das ist eine Frage, die die Wissenschaft bisher nicht überzeugend beantworten kann: Was nutzen Stiftungen eigentlich? Und welchen Effekt haben sie auf geschichtliche Entwicklungen gehabt? Eine Antwort bleiben auch Experten des modernen Stiftungswesens schuldig. Natürlich waren etwa die mittelalterlichen Spitalstiftungen durch Bürger ein großer Durchbruch für das Gesundheitswesen, denn damit wurde erstmals die städtische Versorgung von Kranken auf Dauer sichergestellt. Insofern gibt es in der Geschichte durchaus stifterische Zäsuren.
Lassen Sie uns über Ihre Arbeitsweise sprechen. Auf welche Quellen greifen Sie bei Ihrer Forschung zurück?
Das ist eine durchaus heikle Frage. Ich bin Mittelalterhistoriker, das heißt, ich arbeite vor allem mit lateinischen Quellen. Bei anderssprachigen Quellen bin ich meist auf Übersetzungen oder Forschungsliteratur angewiesen. Dieses Vorgehen lässt sich methodisch so lange rechtfertigen, wie man ein Phänomen betrachtet, das in verschiedenen Kulturräumen eindeutig identifizierbar ist. Bei der Stiftung ist das der Fall.
Um diesen Blick zu erweitern, war der mit 2,5 Millionen Euro dotierte „Advanced Grant“ des European Research Council, den ich 2012 erhalten habe, ausgesprochen hilfreich. Diese Förderung hat es mir ermöglicht, fünf Jahre lang Kolleginnen und Kollegen anderer Fächer zu beschäftigen, die mit mir zusammen die dreibändige „Enzyklopädie des Stiftungswesens in mittelalterlichen Gesellschaften“ geschrieben haben. Mit dabei waren eine Indologin, ein Islamwissenschaftler, ein Sinologe, ein Byzantinist, ein Judaist und ein Mediävist, wobei jeder aus seiner Fachrichtung einen Beitrag zur Geschichte der Stiftungskulturen leistete. Auf diese Weise konnte ich mein Defizit an Sprachkenntnissen ausgleichen.
Sie selbst haben vor zwölf Jahren gemeinsam mit Ihrer Frau die Michael-und-Claudia-Borgolte-Stiftung zur Förderung der Geschichtswissenschaften an der Humboldt-Universität gegründet, die Preise für Historikerinnen und Historiker vergibt. Wie gründet man eine Stiftung, wenn man sich so lange wie Sie mit der Geschichte des Stiftens auseinandergesetzt hat?
Es ist sicherlich kein Zufall, dass ausgerechnet ich eine Stiftung gegründet habe. Es gibt aber eine ganz klassische Voraussetzung unserer Gründung: Wir haben keine Kinder. Da wir beide ein Leben lang gearbeitet, Bücher geschrieben und sonst im Staatsdienst ordentlich verdient haben, ist natürlich etwas Geld übrig geblieben. Darüber hinaus fühlte ich mich der Humboldt-Universität sehr verbunden, an der ich fast 30 lang Professor war und der ich etwas zurückgeben wollte. Auch das ist typisch für eine Professorenstiftung, die es bereits im Mittelalter gab. Und sicherlich wird auch etwas Eitelkeit dabei gewesen sein, das will ich gar nicht leugnen. (lacht)
Eine letzte Frage: Was lässt sich aus der Geschichte der Stiftungen lernen?
Dass zwar einzelne Stiftungen eingehen können, aber die Stiftung selbst immer überleben wird – als Idee und in der Realität.
Theo Starck
Alle Beiträge von Theo StarckÜber den Gesprächspartner
Prof. Dr. Michael Borgolte lehrte über 25 Jahre als Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Berliner Humboldt-Universität. Auch nach seiner Emeritierung 2016 blieb er als Senior Researcher an der Berliner Universität. Zudem war er bis September 2021 Gründungsdirektor des Instituts für Islamische Theologie. Er gründete die Schriftenreihe „StiftungsGeschichten“, schrieb die bereits zum Standardwerk gewordene Monographie „Weltgeschichte als Stiftungsgeschichte“ und publizierte die „Enzyklopädie des Stiftungswesens in mittelalterlichen Gesellschaften“.
Aktuelle Beiträge
Interview zur Strategie 2025 des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen
Aktive Interessenvertretung, eine starke Stimme der Zivilgesellschaft, zielgruppenspezifische Services und Netzwerke, Einsatz für die Zukunft des Stiftens: Generalsekretärin Kirsten Hommelhoff und die Vorstandsvorsitzende Friederike von Bünau sprachen mit Stifter TV über die Strategie 2025.
MehrGemeinsam stärker in Europa und weltweit
Immer mehr Stiftungen denken globaler, tauschen grenzübergreifend Wissen aus, kooperieren bi- oder multinational.
Mehr„Wir haben uns etwas sagen zu lassen“
Als im Mai dieses Jahres der Afroamerikaner George Floyd von einem Polizisten getötet wurde, erklärte sich das Stadtmuseum Berlin als eine von wenigen Stiftungen in Deutschland offen solidarisch mit der weltweit aufkommenden #BlackLivesMatter-Bewegung. Im Gespräch erklären Direktor Paul Spies und Diversitäts-Agentin Idil Efe, wie sie ihr eigenes Haus bunter machen wollen.
Mehr"Zum Wohle der Witwen und Waisen" – neu interpretiert
Fünf soziale Einrichtungen, darunter einen Seniorentreff, unterhält die Koepjohann’sche Stiftung. In der DDR hatte der Berliner Stiftung, die in diesem Jahr 230 Jahre alt wird, noch das Aus gedroht. Ein Gespräch mit den ehemaligen und amtierenden Kuratoriumsvorsitzenden der Stiftung über die ewige Angst vor Enteignung und die Neuerfindung der Stiftung nach dem Mauerfall.
"Stiftungen müssen einen unübersehbaren Beitrag zu den großen Fragen unserer Zeit leisten"
Bildung, Digitalisierung, Gesundheit, Klima, gesellschaftlicher Zusammenhalt: Stiftungen spielen eine wichtige Rolle in unserer Demokratie. In seiner Dankesrede ruft Stifterpreisträger Hans Schöpflin zu mehr Engagement von Stiftungen auf.
Der Mutmacher Hans Schöpflin – eine Würdigung
Nichts im Leben bleibt, wie es ist: Diese tief durchlebte Erkenntnis zeichnet den Träger des Deutschen Stifterpreises 2020 aus und begründet seine Philanthropie. Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen am 11. November 2021 in Frankfurt am Main wird dem Unternehmer Hans Schöpflin die höchste Auszeichnung des deutschen Stiftungswesens verliehen.